Wie die geneigten LeserInnen im vorigen Eintrag erfahren durften, hat Jennings am Anfag der Geschichte keinerlei Ahnung, wozu er diese sieben „trinkets“ brauchen kann, die er sich anstatt der vielen Credits aushändigen lässt, ja er wehrt sich sogar gegen den Gedanken, dem Wertvollen das vermeintlich Nutzlose vorgezogen zu haben. Im Laufe von Dicks „Paycheck“ realisiert Jennings aber die Sinnhaftigkeit der Gegenstände, mit deren Hilfe er sich immer wieder aus den diffizilsten Situationen befreien kann.
„First, the wire and the bus token. Getting away from the Police. It seems funny, but if I hand't them, I'd be there yet.“ (Dick 1987, S. 368)
Sein anderes Ich – oder „he“, wie er sein vergangenes Ich, dessen er sich während der vergangenen zwei Jahre nicht mehr entsinnen kann, selbst in der Geschichte zu nennen pflegt – heckte einen akribisch durchdachten Plan aus. Immer wieder stellt er vollen Stolzes fest, dass „he“ alles was ihm im Jetzt der Kurzgeschichte geschieht, bereits vorhergesehen hat. Doch womit?
„...how had he – his earlier self – known that a piece of wire and a bus token would save his life? He had known, all right. Known in advance. But how?“ (Dick 1987, S. 361)
Mit Hilfe eines „mirror to see“, einer Art Fenster, mit dem man in die Zukunft sehen kann und auch aktiv eingreifen durch einen „scoop to pick up things“, einer metallernen Kralle, einem Greifapparat.
Als Mechaniker hatte er Zugriff darauf und war natürlich neugierig auf seine eigene Zukunft und sah eben all jene Vertstrickungen vorher, die ihm bevorgestanden haben.
Im Laufe von Philip K. Dicks düsteren Zukunftsszenario rund um zwei rivalisierende Mächte, dem „corporates“ und dem „government“, mit der Security Police als Exekutive und Jennings als Spielball zwischen den Fronten, stellen sich dem Protagonisten und mir Fragen über das Wesen der Zeit, Zukunft sowie dem Schicksal.
„Maybe the future was variable.“ (Dick 1987, S. 374)
Wenn nun Jennings mit Hilfe des Zeitfensters in die Zukunft schauen, darin aktiv eingreifen und sie somit zu seinem Gunsten verändern kann, muss die Zukunft variabel sein, müsste man die Möglichkeit eines a priori existierenden Schicksals verneinen. „He had already seen all this. Like God, it had already happened for him. Predetermined.“ (Dick 1987, S. 374)
P – r – e – d – e – t - e – r – m – i – n – e – d. „He could not err. Or could he?“ (Dick 1987, S. 374)
Das Leben ist mit der Möglichkeit des Vorhersehens demnach nicht mehr vorherbestimmt.
Sofern man sein zukünftiges Leben sieht – nun, hat man es gesehen und weiß darüber bescheid. Ab diesem Zeitpunkt ist es also kein Ding der Unwissenheit mehr, kein nebulöses Etwas, das einmal unerwarteterweise auf jemanden zukommen mag. Man ist nun dazu imstande, die Gegenwart so zu manipulieren, um die Zukunft zu eines Gunsten zu gestalten.
ODER: Trifft genau diese Zukunft, die man gesehen hat, nur deswegen ein, WEIL man sie bereits gesehen hat? Und die Möglichkeit der Veränderung ist bloß eine Illusion...eben darum, weil alles, was man von nun an verändert, eben genau jenes Ereignis herbeiführt, das man eigentlich vorhatte zu verhindern.
Dieser Überlegung zu Folge sieht man sich mit – je nach Betrachtungsweise – einer Ohnmacht gegenüber des Lebens konfrontiert. Eine Ohnmacht, die gedeutet werden kann als Schönheit des Zufalls, als ständiger Quell der Veränderung hin zum Guten oder Schlechten, ohne eines Wissens darob – was jeglichen Bedenken, Sorgen, die so viele Menschen plagen, den Nährboden entzieht (eigentlich entziehen müsste!).
Oder eine Ohnmacht, der man sich gegenüberstehen sieht, die den Menschen als Schicksalsgebeutelten entlarvt, der sich der harschen Realität in letzter Konsequenz nur ergeben kann, als Spielball der Götter, der Kräfte des Universums, je nachdem. Grauzonen eingeschlossen.
Ab diesem Punkt sind eigentlich Überlegungen von Schicksal und Determinismus meines Erachtens redundant, gibt man sich eines gewissen Relativismus hin:
Ob nun das Leben, die Zukunft, die ständigen Variationen ausgeliefert ist, ein Zusammenspiel aus Zufällen ist, das als einzige Konstante den Tod hat; oder ob es einem Schicksal unterworfen ist, dem man sowieso nicht entgehen kann, selbst mit der Möglichkeit, die Zukunft zu sehen (siehe Ausführungen oben), ist letztendendes hinfällig hinsichtlich der „Tatsache“, ja, des Allgemeinplatzes (!), dass man sowieso „nur leben“ kann. Was man daraus macht sei jedem freigestellt.
Jennings möchte sich in „Paycheck“ zumindest in Sicherheit wissen; „I want be safe. You don't know what it's like, being out there, with no place to go. And individual has no place to turn to, anymore. No one to help him. He's caught between two ruthless forces, a pawn between political and economic powers. And I'm tired of being a pawn.“ (Dick 1987, S. 380)
Er nutzt „mirror“ und „scoop“, um sich den beiden Kräften, die nahezu schrankenlos agieren können (Regierung und Firmen, Vgl. Kräfte des Universums etc), nicht mehr hilflos ausgeliefert zu fühlen, um sich in Sicherheit wähnen zu können und kein Spielball zwischen zwei Fronten zu sein.
Das Ende stellt es relativ frei, wie es nun weitergeht. Man weiß nicht, ob Jennings weiter geplant hat, als bis zu dem Zeitpunkt, an dem er gegenwärtig aus der Vergangenheit mit dem „time scoop“ Kelly das letzte „trinket“ entreißt. Es bleibt ungewiss, wie es nun überhaupt weitergehen wird in dieser Welt, die Dick mit „Paycheck“ entwirft, ob der Krieg nun ausbricht, die Revolution stattfindet. Die „Zeitmaschine“ ist noch nich repariert, die Zukunft nebulös. Fast wie im wirklichen Leben...
Quellen:
Dick, Philip K.: „Paycheck“, in: The Philip K. Dick Reader, New York: 1987.
Quaids Identität
vor 14 Jahren
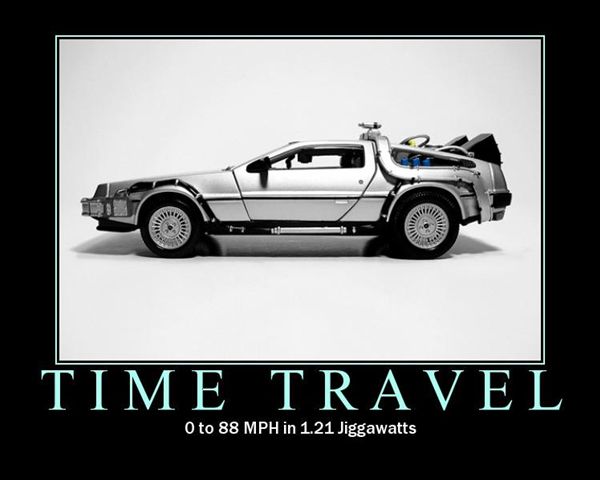
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen